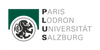Ap Prof.in Dr.in Corinna Peil
Stellvertretende Leiterin der Abteilung Center for ICT&S
Fakultätskuriensprecherin des Mittelbaus der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät
Redaktionsleitung kommunikation.medien

Raum: 1. Stock, Sigmund-Haffner-Gasse 18, 5020 Salzburg
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Telefon: +43-662-8044-4814
Mail: Corinna.Peil@plus.ac.at
Dr. Corinna Peil ist Professorin in der Abteilung Center for ICT&S, Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Sie studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sowie Film- und Fernsehwissenschaft in Bochum und Brüssel und promovierte in Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg. Ihre Habilitation („Infrastructures of Care. Digitale Medientechnologien und Alltag“) schloss sie 2024 ab.
Zu ihren Forschungs- und Lehrthemen gehören Medien(de)konvergenz, digitale Kommunikation und Nachhaltigkeit, Internetgeschichte, Smart Farming und digitale Alltagskulturen. Sie lehrte an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland und leitet seit 2012 das Open-Access-Journal kommunikation.medien, das im Rahmen einer Lehrveranstaltung von Masterstudierenden redaktionell betreut und veröffentlicht wird.
- (De-)Convergence Cultures
- Internet of Things
- Digitale Resilienz
- Mobilkommunikation
- Digitale Medienkommunikation in Alltagskontexten
- Mediatisierungsprozesse
- Neue Medien in Geschichte und Gegenwart
- Association of Internet Researchers (AoIR)
- International Association for Media and Communication Research (IAMCR)
- European Research and Education Association (ECREA)
- Österreichische Gesellschaft für Kommunikationswissenschaft (ÖGK); seit 2018 im Vorstand
- Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK); seit 2019 Ko-Sprecherin der DGPuK-Fachgruppe Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht
Die aktuelle Forschungsdokumentation findet sich hier.